|
ei8ht days a week – Streifzüge durch den Wandel
|
mit Boris Kochan und Freunden am 17. August 2025 |
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
»die Apparate emanzipierten sich: Was dazu da gewesen war, eine Sprechverbindung zu eröffnen, war plötzlich ein Spiegelkabinett, vollgestopft mit Bildern. Ganze Daten-Halden führten wir mit uns, sinnvoll-sinnlos, nützlich-nutzlos geballte Nachrichtenkomplexe, Kaufanreize, Orientierungsangebote, Wellnessofferten. Was ein Telefon gewesen war, wurde ein Zentralrechner, was ein Hemd war, ein Thermometer, ein Haus wurde eine Komfort-Maschine.« Roger Willemsen, der in diesen Tagen 70 Jahre alt geworden wäre, versetzte sich in seiner letzten Rede Wer wir waren in die Perspektive künftiger Generationen: ein Blick aus der Zukunft zurück ins Jahr 2015. Was er dort beschreibt, ist keine Technikgeschichte, sondern Menschenkunde – wie Dinge, die uns dienen sollten, zu Apparaten wurden, die uns sanft wie deutlich dominieren. Aus Komfort wurde Überforderung, aus Erleichterung eine neue Form der Abhängigkeit.
»Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung.« Eine Gesellschaft, die im Konfettiregen von Daten und Fakten taumelt – wissend, aber handlungsunfähig. Ein Ich, das schrumpft und sich zugleich grotesk aufbläht. Müdigkeit, Überdruss, stille Kapitulation: der paradoxe Zustand einer Welt, die alles weiß und doch nicht handelt.
Beim Designforscher Felix Kosok klingt die Auseinandersetzung mit Apparaten und Geräten anders, aber nicht weniger eindringlich. In Form, Funktion und Freiheit vertieft er die weithin geteilte Einsicht, dass Design nie neutral ist: Es kaschiert Macht im Gewand der Bequemlichkeit – und prägt so, oft unbemerkt, unser gesellschaftliches Miteinander. Parkbänke, die Obdachlose am Schlafen hindern. Interfaces, die Wahlmöglichkeiten nur vortäuschen. Algorithmen, die bestehende Vorurteile fortschreiben und damit systematisch Diskriminierung verstärken. Während Willemsen die kulturellen und existenziellen Folgen solcher Entwicklungen in den Blick nimmt, legt Kosok offen, wie sie in den konkreten Gestaltungen des Alltags wirksam werden – und so über Teilhabe oder Ausschluss entscheiden.
So verschieden ihre Perspektiven sind, beide insistieren auf Haltung. Willemsen fordert, Hoffnung als Widerstand zu begreifen – nicht als Vertröstung, sondern als Praxis gegen Resignation. Kosok zeigt, dass Gestaltung dann Zukunft eröffnet, wenn sie Vielfalt zulässt und Handlungsspielräume schafft, statt Perfektion zu versprechen. In dieser Spannung – zwischen der Warnung vor dem Verlust der Utopie und dem Vertrauen darauf, dass jeder Entwurf ein Vorgriff auf Zukunft sein kann – entsteht ein gemeinsames Bild: Hoffnung ist kein Gefühl, sondern eine Praxis. Sie lebt vom Unterbrechen der Rasanz, vom Beharren auf dem Offenen – und von Gestaltung, die ermächtigt, nicht entmündigt. Am Ende steht eine Einladung: die Welt nicht hinzunehmen, sondern sie zu gestalten. Ich wünsche einen entspannten Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche!
Boris Kochan
|
|
|
Mit dieser 8daw-Ausgabe verabschieden wir uns in die Sommerpause. Auch wenn es im ersten Halbjahr bereits reichlich Erscheinungspausen gegeben hat – die Bundeskonferenz des Deutschen Designtags DIVE’25 hat fast alle Kräfte gebunden –, gönnen wir uns nun ein Innehalten, um über Takt, Rhythmus und vielleicht auch ein paar frische Ideen nachzudenken. Ende September sind wir wieder da – mit neuem Vergnügen an mäandernden Streifzügen durch den Wandel.
|
|
|
In der lustvollen Übertreibung, in der kalkulierten Groteske, liegt Helmut Newtons immer wieder erstaunliche Präzision: Er seziert die Verflechtung von Technik, Begehren und Macht, ohne sie zu entlarven – er zeigt sie, grell, schön, ironisch. So kalt wie komisch inszeniert er den Menschen als Apparat(schik), als funktionales Glied einer Kultur, die ihre eigenen Obsessionen im Bild der Maschine spiegelt. Newton verschränkt Körper und Gerät zu Doppelwesen – Muskelapparat, Beatmungsapparat, Kraftapparat, Entspannungsapparat. Nicht die Maschine wird vermenschlicht, sondern der Mensch verapparatisiert. Bilder zwischen Pose und Parodie – glamourös und grotesk.
|
|
|
Geräte, die für einen bestimmten Zweck entwickelt werden, nennt man Apparate (lat. apparare, das Erforderliche herbeischaffen, vorbereiten). Ab dem 18. Jahrhundert wird das Wort auch auf Personengruppen oder Einrichtungen übertragen, die spezielle Aufgaben übernehmen. Beide Apparate-Cluster – da der Sprech- oder Fernsehapparat, dort der Kontroll- oder Staatsapparat – sind nicht selten mit einer, sagen wir mal eher klebrigen Rückwärtsgewandtheit behaftet. Der technische Fortschritt aber hat aus Apparaten Automaten, Maschinen, Roboter gemacht. Die Begegnung und Verschmelzung von Mensch und Apparat/Maschine fasziniert schon in der antiken Mythologie. Dort baut Hephaistos, Gott des Feuers und der Schmiedekunst, einen menschenähnlichen Roboter als Werkstattgehilfen. 1814 erzählt E.T.A. Hoffmann die unheimliche Geschichte einer Automaten-Figur. Fritz Lang schickt 1927 in Metropolis die Maschinen-Maria über die Leinwand. In vielen Collagen von Max Ernst tauchen technoide Körper (und ihre vogelköpfigen Verwandten) auf. Alexander McQueen erfindet in seiner Herbst/Winter-Kollektion 1998 die Maschinen-Maria neu: zwischen Natürlich- und Künstlichkeit, fixierendem Harnisch und sinnlicher Lebendigkeit.
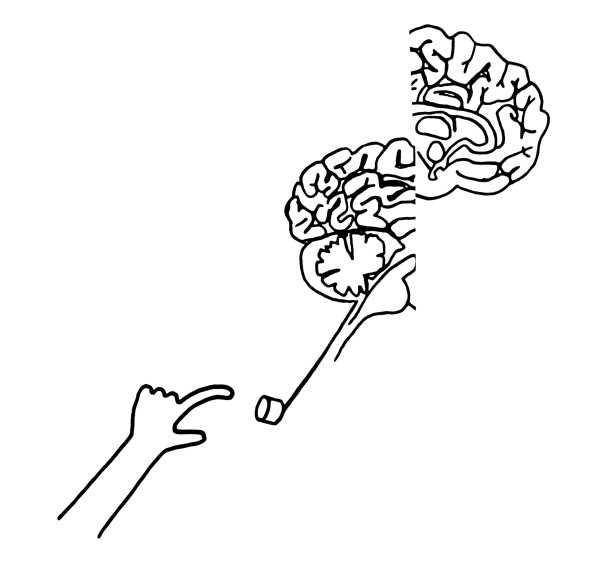
2023 wirft der Lyriker J. O. Morgan in Der Apparat Fragen nach der Zukunft der Menschen in einer technologiegetriebenen Welt auf – ohne den Begriff Künstliche Intelligenz zu erwähnen. Was passiert mit unseren Gefühlen, mit unserer Neugierde, unseren Gedanken, wenn wir unser Gehirn nicht mehr zum Selberdenken gebrauchen? Durch Denken, Lernen, Üben formen wir unser Gehirn, das sich je nach Nutzung umstrukturieren, anpassen, ausbauen oder bei Nichtgebrauch auch zurückbilden kann. Christian Morgenstern schreibt wohl 1892 in einem Brief: »Aber es ist auch dies ein Zeichen unserer krankhaft-überreizten Zeit, dass sie die Fähigkeit eigenen Denkens immer mehr aufgibt.« [gw]
|
|
|
Ein äußerst gelungener Versprecher unterlief der geschätzten Marietta Slomka, als sie im Gespräch mit Kanzleramtschef Thorsten Frei den Digitalminister Karsten Wildberger mit den Worten vorstellte, mit ihm sei im Kabinett auch ein Quereinsteiger dabei, dem die Aufgabe zufalle, das Digitalmuseum aufzubauen (im Video bei Minute 02:53). Natürlich hat Slomka, die sich ein Grinsen selbst nicht verkneifen konnte, ihren Fauxpas sofort korrigiert, aber da war das Kind schon im Brunnen gelandet und im Netz lachte man sich über diese treffliche Freud’sche Fehlleistung schlapp. Als vormaliger Vorstandsvorsitzender u.a. der gerade an Chinesen verkauften MediaMarkt-Saturn-Gruppe, der überhaupt erst seit Mai dieses Jahres Mitglied der CDU ist, kann Wildberger geradezu als Paradebeispiel eines Adhoc-Quereinsteigers herhalten, was ja erst mal nicht unbedingt schlecht sein muss. Nicht von ungefähr eilt Quereinsteiger·innen der Ruf voraus, für frischen Wind abseits ausgetretener Pfade zu sorgen. Ähnliches galt auch einmal für Querdenker·innen, bevor jene kleine, aber umso lautstärkere Bevölkerungsgruppe dieses Wort als Aushängeschild für ihr trostloses Treiben beschlagnahmt hat.

Querdenker·innen alten Schlages waren hingegen eine stolze Spezies: schlau, frech, unberechenbar, manchmal auch ein bisschen elitär, aber auf jeden Fall der glatte Gegenentwurf zum eher stromlinienmäßig geformten Apparatschik. Apparatschiki wurden in Russland nach der Revolution systemkonforme Funktionäre (zumeist Männer) genannt, die dem Apparat und sonst niemandem dienten und es mit etwas Glück und guten Beziehungen bis zum Bonzen bringen konnten. Kein Wunder, dass der Begriff Apparatschik in viele Sprachen Eingang gefunden hat, weil es Menschen dieses Typs so ziemlich überall gibt – aber vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil es einfach ein ganz tolles Wort ist. Ein Wort, das rattert, knattert und zischt wie eine alte Dampfmaschine, an deren Hebeln Menschen mit gewichtiger Miene hantieren. Hoffen wir also, dass das neue Digitalmuseum – Verzeihung – Digitalministerium nicht von so einer Maschine angetrieben wird. [um]
|
|
|
Ein berühmter Quereinsteiger war Apple-Gründer Steve Jobs, der nach einem abgebrochenen Studium der Physik und der Literaturwissenschaften in die IT-Branche einstieg. Am Digitalen war er jedoch schon in jungen Jahren interessiert, wie ein ziemlich lustlos ausgefülltes Bewerbungsschreiben des 18-Jährigen zeigt, das 2018 für unglaubliche 175.000 Dollar versteigert wurde.
|
|
|
Kafkaesk ist, wenn ein Weltliterat freiwillig Texte verfasst, die erwiesenermaßen von 95% der Menschen ignoriert werden. Franz Kafka schrieb neben Prozeß, Verwandlung und Schloss – Gebrauchsanleitungen. Nun liegt ja das eine vom anderen gar nicht so weit entfernt, schließlich stammt von Kafka der Satz »Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns« – ein Werkzeug also, mit dem sich die Verkrustung der menschlichen Seele aufbrechen lässt, und Gebrauchsanleitungen sind ja nun auch nur Behelfe, um mit Geräten zurechtzukommen, die sich dem Menschenverstand verschließen und vermuten lassen, dass die ethymologische Herleitung des Begriffs Gerät entgegen der Erläuterungen im Wörterbuch eben doch nicht auf Rat, Beratung zurückgeht, sondern auf raten im Sinne von rätseln. Klingt ja auch viel ähnlicher. Die Frustration konnte in den Anfangsjahren der Elektrifizierung derart hoch sein, dass etwa der Theaterleiter Sir Beerbohm Tree nach seiner ersten Begegnung mit einem Grammophon angeblich an den Hersteller schrieb (gab es damals schon die Aufforderung: Gib Deine Bewertung ab!?): »Sehr geehrte Herren, ich habe Ihre Maschine geprüft. Sie bringt neuen Schrecken in unser Leben und macht den Tod zu einem langgehegten Wunsch.« Eine Formulierung, die man sich merken möchte für die nächste Produktbewertung auf Amazon zur neuen Waschmaschine oder zum Smart-Home-System. Wobei die Demütigung des potenziellen Benutzers ja teilweise durch die zugehörige Bedienungsanleitung eher potenziert wird. Denn dass das System der Funktionsbeschreibung mit Ziffern und Buchstaben in einer Zeichnung, die dann im Fließtext aufgelöst werden, vom Universalgenie Leonardo da Vinci stammt, möchte kaum glauben, wer stundenlang über den grafischen Montageanleitungen eines schmucklosen Billy-Regals brütet – kein Wunder, dass die Dinger auch Explosionszeichnungen genannt werden. Sodass wohl mancher Nutzer, bevor er explodiert, sich lieber auf Versuch und Irrtum verlässt.
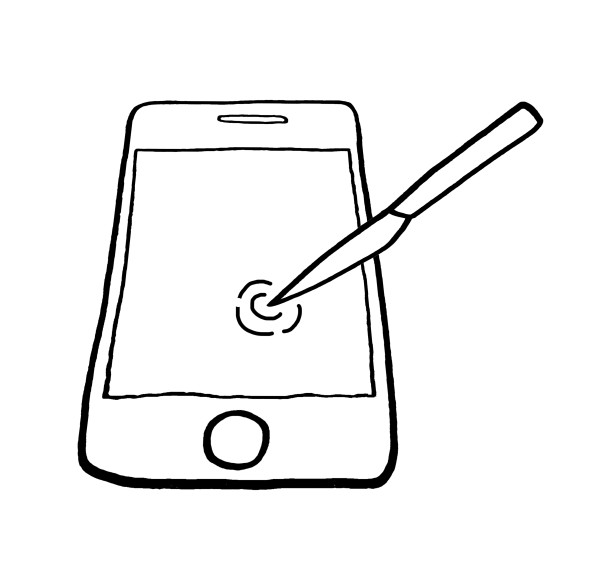
Was tatsächlich inzwischen beim ein oder anderen Gerät auch ganz gut klappt – dank intuitiver Benutzerführung. Im Alltag dagegen ist eher eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Man darf davon ausgehen, dass der zitierte Sir Beerbohm Tree, wenn draußen dunkle Wolken aufzogen, in der guten Stube blieb, weil er Gewittergefahren intuitiv erkannte. Heute müssen Metereologen im Wetterbericht darauf hinweisen, dass bei Gewitter Lebensgefahr bestehe: Es kann zu Blitzschlag kommen! Donnerwetter! [sib]
|
|
|
Diesmal kein Kalender ... |
|
| sondern ein urlaubsförderlicher Hinweis auf unsere Gastro-Rubrik |
|
|
culinary forays were invented by Laura Meseguer and Boris Kochan, simply because they kept being asked for tips on restaurants, bars and markets in all corners of the world. It has since become a rather slowly growing section on our 8daw website – the only one, by the way, that appears in English. This way, whenever inquiries arrive from abroad, we can just point people to the site instead of writing the same recommendations over and over again. And since holiday season has already kicked off, we thought it was about time to remind you of this little corner of our website – a gentle invitation to browse, discover, and maybe even plot your next trip around a good meal. By the way, the picture above comes from the tiny corner restaurant La Balabusta in Barcelona – one of those lovely cases where Laura discovered it first, and Boris only recently had the chance to finally check it out himself.
|
|
|
|
|
Einen Toast auf den familiengerechten Schmierapparat!
|
|
|
In der 8daw-Ausgabe
BETA #13 vom 24. Juli 2020 haben wir uns unter anderem mit dem
Thema geschlechterspezifische Schreibweise beschäftigt. Im Ergebnis fanden
wir die Empfehlung eines Lesers für uns am geeignetsten: »Der Mittelpunkt
(MacOS: Shift+Alt+9; Windows: Alt+0183) wird eingesetzt wie der Asterisk *,
stört jedoch deutlich weniger den Lesefluss der Leser·innen,
weil er nicht nach Fußnoten ruft und auch keine Textlücken reißt wie der
Gender_Gap. Im Hinblick auf Lesbarkeit und Typografiequalität also eine
bessere Alternative, und inhaltlich – als Multiplikationszeichen
verstanden – treffend. Oder?« Wir stellen unseren Autor·innen jedoch
frei, ob sie den Mittelpunkt oder eine andere Form benutzen.
Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind jedenfalls geschlechtsneutral
zu verstehen.
|
|
|
|
8daw ist der
wöchentliche Newsletter von Boris Kochan und Freunden zu Themen rund um den
Wandel in Gesellschaft, Kultur und Politik, Unternehmen und Organisationen.
Er erscheint in Verbindung mit Kochan & Partner und setzt so die
langjährige Tradition der Netzwerkpflege mit außergewöhnlichen
Aussendungen in neuer Form fort. 8daw versteht sich als Community- und
Kollaborations-Projekt insbesondere mit seinen Leser·innen –
Kooperationspartner sind darüber hinaus zum Beispiel die GRANSHAN Foundation, die
EDCH Foundation, der Deutsche Designtag (DT), der BDG Berufsverband der Deutschen
Kommunikationsdesigner und die Typographische Gesellschaft München (tgm).
|
|
|
|
|
|
|
|