|
ei8ht days a week – Streifzüge durch den Wandel
|
mit Boris Kochan und Freunden am 17. Februar 2025 |
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
»Musik besitzt die einzigartige Fähigkeit, tief in unsere Seele einzudringen und uns an Stellen zu berühren, die für Worte unerreichbar bleiben. Sie weckt Emotionen und Erinnerungen, entführt uns in andere Welten und überwindet vermeintliche Unterschiede. Dabei stiftet sie Gemeinschaft – auch über kulturelle und soziale Grenzen hinweg.« Einer, der genau diese Idee von Musik vorlebt, ist Sir Simon Rattle, Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, dem am 17. Mai für sein Lebenswerk der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen wird. Eigentlich ein idealer Aufhänger, um über die verbindende Kraft der Musik zu schreiben und darüber, wieviel Geduld und Fleiß es bedarf, bis Finger oder Lippen oder welche Körperteile auch immer mit äußerster Genauigkeit die musikalischen Gedanken und Gefühle einer Interpretin oder eines Interpreten in Klang verwandeln. All das hatte ich mir für dieses Editorial vorgenommen: Wieder mal einen Streifzug abseits von politischen Beben und Schlagzeilen wollte ich unternehmen und dabei wäre es mir nicht zuletzt auch um das Wechselspiel von Präzision und Abweichung gegangen, wie etwa im Jazz beim spontanen Spiel mit Rhythmus und einem atmenden Zeitgefühl. Dann, am Donnerstag der entsetzliche Anschlag auf die Teilnehmer einer Gewerkschaftsdemonstration in München und tags darauf – ebenfalls in München – die Rede des US-Vizepräsidenten auf der Sicherheitskonferenz mit seiner »fast schon übergriffigen« (Zitat: Friedrich Merz) Infragestellung der demokratischen Verfasstheit Europas. Wie nach alledem einfach so über Musik schreiben? Nicht gerade förderlich war, dass mir dann noch die sarkastische Bemerkung Frank Zappas: »Jazz is not dead, it just smells funny« einfiel. Hätte es nicht vielleicht auch den komischen Geruch von Weltabgewandtheit, sich ausgerechnet jetzt auf Fragen von Kunst und Können zu kaprizieren, auf Jazz und Groove womöglich und darauf, wie Musiker·innen fern vom Lärm der Welt draußen ihren einsamen Übungen im freilich gar nicht so stillen Kämmerlein nachgehen? Dann aber kam der Auftritt von Boris Pistorius auf der Sicherheitskonferenz mit seiner bemerkenswert entschiedenen Antwort auf die Polemik von J.D. Vance. Was mich daran besonders beeindruckt hat, waren die Emphase und gleichzeitige Klarheit und sprachliche Präzision mit der er dies tat, ganz im Sinne der Pianistenlegende Vladimir Horowitz, der einmal über das Klavierspielen sagte, es bestünde aus: »Vernunft, Herz und technischen Mitteln. Alles sollte gleichermaßen entwickelt sein. Ohne Vernunft sind Sie ein Fiasko, ohne Technik ein Amateur, ohne Herz eine Maschine.« Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Wochenanfang!
Ulrich Müller
|
|
|
Er wird gelegentlich der Chefcharismatiker unter den Spitzendirigenten genannt: Wie sehr Sir Simon Rattle Musik lebt und dies auch zu vermitteln vermag und nicht zuletzt warum er zu den bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart gehört, wird auf höchst sympathische Weise in diesem Probenstreiflicht des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunk spürbar.
|
|
|
Nach dem Aufwärmen beginnt der normale Arbeitstag von Balletttänzer·innen mit dem Morgentraining, der Class, wenn unter dem strengen Blick von Ballettmeister·innen das Repertoire klassischer Bewegungsabläufe trainiert wird. Sprünge und Pirouetten und was sonst noch dazu gehört – und das mit äußerster Präzision bis an die Grenzen des körperlich Möglichen. Danach heißt es bis manchmal nachmittags entweder Detailarbeit an Stücken, die auf dem aktuellen Spielplan stehen oder das Einstudieren einer neuen Choreografie – für manche aber auch der Gang zur Physio, denn die Körper von Tänzer·innen sind enormen Belastungen ausgesetzt. Spätnachmittags dann nochmal eine Pause, die viele nutzen, um ihre Rollen durchzugehen, ihre Soli, Pas des deux oder Gruppenszenen und dann geht es auch schon auf die Bühne, wo die Tänzer·innen im Zusammenspiel mit Musik, Kostüm, Licht und Bühnenbild mitunter die Schwerkraft zu überwinden scheinen. Momente, die die in Moskau geborene Fotokünstlerin und Psychologin ‚ in ihrer Zusammenarbeit mit dem New York City Ballet auf einzigartige Weise einfängt, auch indem sie durch die digitale Nachbearbeitung ihre Bilder noch einmal in neue Kontexte setzt. Dabei sucht sie hinter der Perfektion der Tänzer·innen immer auch die menschliche Unzulänglichkeit: »Sie performen auf die technisch perfektest mögliche Art und Weise«, sagt Porodina, aber wären sie tatsächlich perfekt »wäre es einfach nur langweilig. Es wäre unmenschlich. Es wäre so, als würde es von einer Maschine produziert. (…) Ich möchte zeigen, dass es zutiefst menschlich ist.«
|
|
|
Wenn präzise genau richtig ist … |
|
Manche Menschen empfinden beim Begriff Präzision Unbehagen, weil darin etwas Militärisches mitschwingt. Anlegen, anvisieren über Kimme und Korn, abdrücken – bumm und tot! Doch man bedenke: Auch wer sich ins eigene Knie schießt und das dreimal hintereinander schafft, ist durchaus präzise – sofern er sein Gegenüber treffen wollte, fehlte es lediglich an Genauigkeit. Denn hohe Präzision, die sogenannte Wiederholgenauigkeit, sagt etwas über eine geringe Streubreite von Ereignissen aus, ergibt aber nur gemeinsam mit der Richtigkeit die angestrebte Genauigkeit: Die Begriffe sind also keinesfalls synonym, wenngleich sie im allgemeinen Sprachgebrauch oft so verwendet werden. Aber, seufz, was ist schon der allgemeine Sprachgebrauch!?
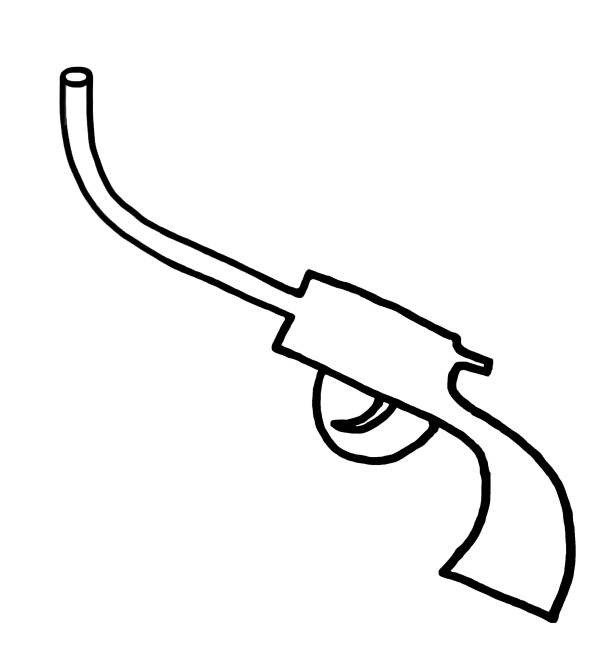
Während präzise sich vom lat. praecisus herleitet, „von der Rede abgebrochen, abgekürzt, zusammengefasst“, also etwas mit knappen Worten auf den Punkt gebracht wird, und die deutsche Schriftsprache als ursprüngliche Kanzleisprache klar und eindeutig war, blähen heute Füllwörter den mit Einheitsphrasen gespickten Text. So gerinnen Attraktionen, Glanzstücke, Spitzenleistungen, Höhepunkte monoton zu Highlights, aus Konferenzen, Ausstellungen und Geburtstagsfesten macht man Events. Und Studentinnen und Studenten werden, weil’s ja so gar keinen Unterschied zu machen scheint, zu Studierenden. Aus Menschen, die den Status haben, an einer Hochschule immatrikuliert zu sein, werden solche, die – Partizip Präsens! – der Tätigkeit des Studierens nachgehen. Wie ungenau diese Begriffsumwandlung ist, macht der Publizist Arnd Diringer klar, wenn er darauf verweist, dass es durchaus tote Studenten, aber – trotz des Trends zum lebenslangen Lernen – keine toten Studierenden geben könne. Auch wenn das sicher eine Leibspeise wäre für den Bücherwurm … [sib]
|
|
|
Auch tote Malende gibt es nicht, tote Maler sehr wohl: Im Februar vor 350 Jahren starb ein Meister der Präzision, Gerard Dou, bekannt aus dem niederländischen Barock, wo er als Begründer der Leidener Feinmalerei gilt. Sein (mit selbst gefertigten Pinseln) gezogener Strich war so feinziseliert, dass er kleinste Details von Oberflächen und stoffliche Beschaffenheiten wiedergeben konnte. Diese Art exakter figürlicher Malerei bezeichnet der belgische Maler Luc Tuyman in einem Gespräch mit Hans Rudolf Reust über Das megalomane Detail als abstrakt: »Figuration hat für mich die Bedeutung, dass etwas sich uns abgelöst gegenüberstellt, statt dass es sich psychologisch entwickelt. Figuration ist das Bild der Struktur, die abstrakter ist als ein abstraktes Bild, weil die Abstraktion von den Bedeutungen noch nicht vorweggenommen ist, sondern sich der emotive Impakt durch die Art der Darstellung im Moment immer neu verliert.«
|
|
|
India Bradley, Unity Phelan und Emma Von Enck
|
|
|
Das Ding in der Schachtel |
|
Ab etwa der 23. Schwangerschaftswoche hören Ungeborene die Sprache ihrer Mutter und gewöhnen sich an Laute und Sprachmelodien. Schon in früher Kindheit entwickeln die Kleinen spielend, intuitiv, im sozialen Miteinander ihre Sprache – um sich mit anderen Menschen verständigen zu können: Jedes Ding hat seinen Namen. Was ist Sprache? Wie kann man sich verständigen? Der Schweizer Autor Peter Bichsel (hier ein Gespräch mit dem Autor) wirft in seinen Kindergeschichten solche Fragen auf. Beispielsweise erzählt er in Ein Tisch ist ein Tisch von einem einsamen Mann, den die Eintönigkeit seines Lebens bekümmert. Er sorgt selbst für Abwechslung, indem er den Dingen andere Namen gibt. Sein Bett heißt jetzt Bild. Und abends legt er sich im Bild schlafen. So entsteht allmählich sein eigenes, privates Sprachuniversum, in dem er schließlich die ursprüngliche Bezeichnung der Dinge vergisst und völlig vereinsamt. Er versteht die anderen Menschen nicht mehr. Und sie ihn auch nicht.
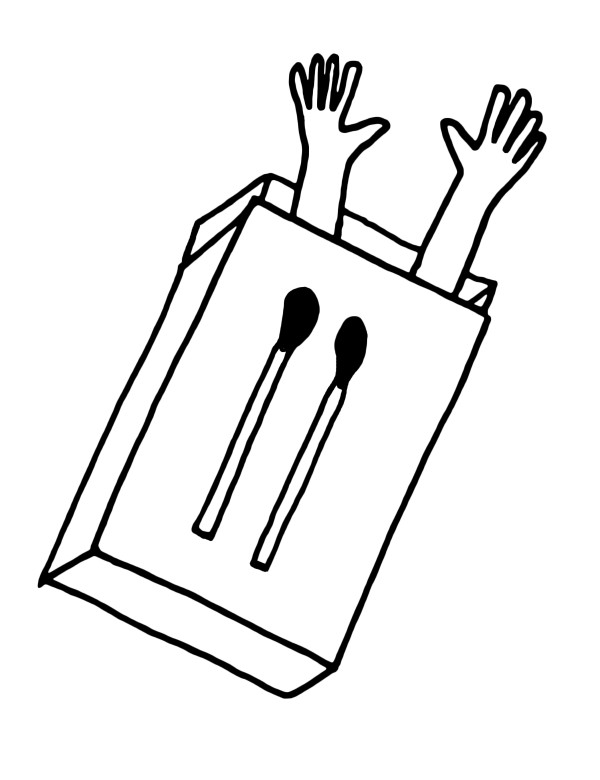
Sprache ist soziale Übereinkunft, sie ist öffentlich, sie folgt Regeln. Und sie hat Grenzen. Gebraucht ein Mensch einen individuellen, privaten Ausdruck (etwa für ein inneres Empfinden wie Trauer), den niemand außer dem Sprechenden selbst identisch nachvollziehen oder verstehen kann, verliert der Ausdruck die Beziehung zur Gemeinschaft. Er ist nicht öffentlich. Er folgt keinen bekannten Regeln. Was nicht verstanden werden kann, kann keine Sprache sein, meint der der Philosoph Ludwig Wittgenstein. In seinen Philosophischen Untersuchungen, insbesondere in seinem Beispiel vom Käfer in der Schachtel hat er diesen Gedanken faszinierend ausgeführt: »Angenommen, es hätte Jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand kann in die Schachtel des anderen schauen; und Jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer sei. - Da könnte es ja sein, dass jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass sich ein solches Ding fortwährend veränderte …« Gut, dass Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus logico-philosophicus auch eine Tür zeigt: »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.« [gw]
|
|
|
Auch Geheimsprachen basieren auf Regeln, die allerdings nur einer kleinen Sprachgemeinschaft vertraut sind. Kinder lieben sie, um Eltern, Lehrer·innen oder die Parallelklasse auszutricksen. Doch ist der Gebrauch von Geheimsprachen keineswegs Kinderkram. Schon Julius Cäsar nutzte ein Verschlüsselungssystem für seine militärische Korrespondenz. Leonardo da Vinci verfasste Gedanken auch in Spiegelschrift. Im Spätmittelalter entwickelte sich eine Geheimsprache bei Bettlern, Hausierern, Gauklern oder Tagedieben: Das Rotwelsch übernahm eine wichtige identitätsbildende, integrative Funktion für soziale Randgruppen. Hochkonjunktur haben Geheimsprachen aber vor allem in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen. Militär und Geheimdienste sind Experten in der Kryptologie, der Wissenschaft der Verschlüsselung. Wer es selbst einmal probieren mag: Diese Geheimsprache ist kinderleicht.
|
|
|
Ashley Laracey und Joseph Gordon
|
|
|
Schrift und Bild. Schon in den prähistorischen Höhlenmalereien entdecken wir (zum Teil bis heute noch nicht entschlüsselte) Zeichen. Was bedeuten die Punkte, Linien, Strichbündel und -bögen, die die Motive rhythmisch begleiten? Seine Schaublätter Ein gute Ordnung umspielt der Nürnberger Schreibmeister Johann Neudörffer d. Ä. um 1540 mit ebenso präzisen wie scheinbar mühelos verschlungenen und verflochtenen Ornamenten. Womöglich um seinen Schülern den Zugang zur strengen Anordnung der kompromisslosen Frakturschrift freundlich zu erleichtern?
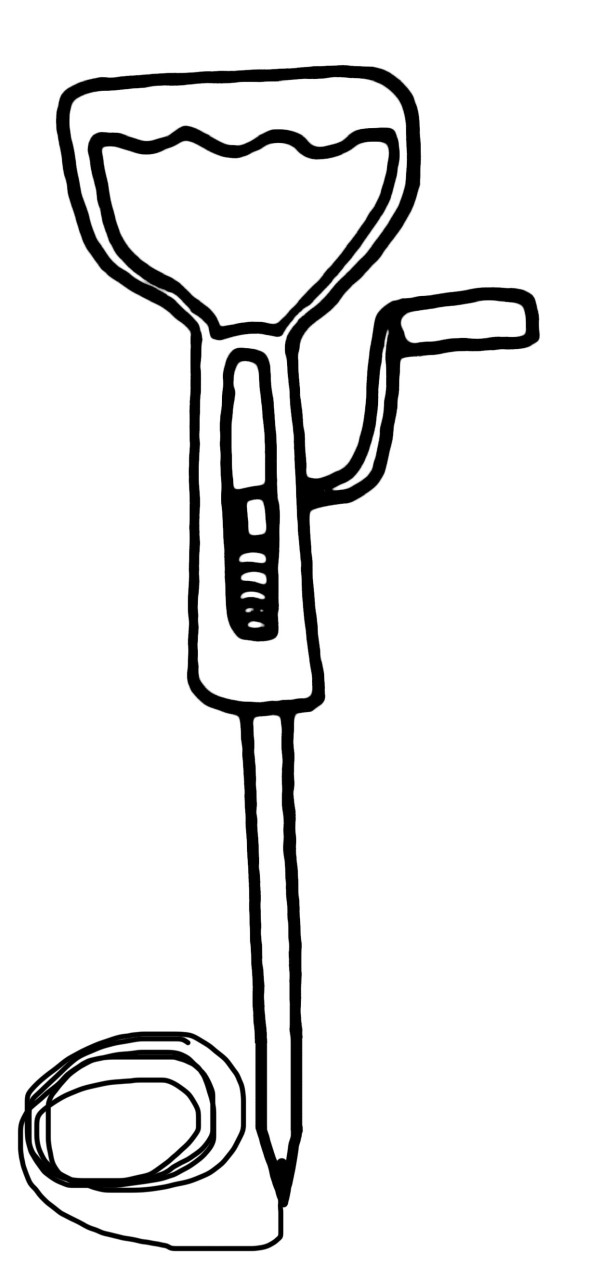
Ein Stift, gar eine Feder liegen heute nicht mehr so nahe. Wie Studien belegen, fällt es Schülerinnen und Schülern immer schwerer, mit der Hand zu schreiben. Doch noch sind die Schätze einer individuellen Handschrift nicht in Vergessenheit geraten. Hier einige wenige: Das Training motorischer Fähigkeiten, von Konzentration- und Gedächtnisvermögen, die Verbesserung der Lesefähigkeit, ein tieferes Verständnis von Worten, Buchstaben, die Entdeckung eines ganz persönlichen Ausdrucks. Zudem regt das freie Schreiben das Gehirn zu neuronalen Verbindungen an, setzt Kreativität frei, lässt Gedanken fließen. Einen malenden Dichter hat man den US-amerikanischer Künstler Cy Twombly genannt, der schlingernde, wuchernde Linien, Bleistiftgekritzel, Textfetzen, Zitatfragmente, Farbballungen übereinander schichtet: Rätselhafte Erzählungen, die weite Assoziationsräume öffnen. Cy Twombly sagte einmal, ein Bild sei eine Passage. Wer sich auf die Durchquerung seiner Passagen einlässt, betritt Abenteuerland. [gw]
|
|
|
Nicht nur die Handschriften des Autors und Letterworkers Timothy Donaldson sind ziemlich bekannt. Geliebt wird er insbesondere wegen seiner energiegeladenen Performances (da kann auch mal ein Besen schreiben) und ihren besonderen Spuren. Hier bei einem Workshop mit Ruben Malayan auf der Granshan Conference in Jerewan.
|
|
| Veranstaltungen,
Ausstellungen und mehr aus dem Umfeld der 8daw-Redaktion |
|
|
Typedesign-Sommerkurs in Reading
|
|
TDi steht für Type Design intensive und richtet sich an erfahrene Schriftgestalter. Ab sofort kann man sich für den Kurs, der an zwei Wochen im Juli an der University of Reading stattfindet, anmelden. Inhaltlich steht das Thema Multiscript im Vordergrund. Die erste Woche vom 7. bis 11. Juli richtet sich an Typedesigner, die lernen wollen, scriptübergreifend zu gestalten. In der zweiten Woche vom 21. bis 25. Juli geht es vor allem um Typedesign-Forschung. Die beiden Wochen können zusammen oder getrennt voneinander gebucht werden. Genauere Infos gibt es auf der Website oder direkt bei Professor Gerry Leonidas. Dieser betont, dass es sich nicht um Einführungskurse handelt. TDi bietet ein intensives Lernumfeld für eine kleine Gruppe, mit erstklassigen Lehrern und einzigartigem Archivmaterial.
|
|
|
28. Februar bis 26. Oktober 2025
|
|
Das Funkeln und Glitzern unzähliger winziger Schneekristalle in der Sonne gehört zu den schönsten Dingen der Welt. Und auch sonst schadet etwas mehr Glitzer im Leben nicht. Aber Glitzer funkelt, flirrt und fasziniert nicht nur, er empört auch. Auf Bühnen ist er ebenso zu finden wie auf Protestplakaten und in Kinderzimmern. Glitzer ist omnipräsent – und doch ist das Museum für Kunst & Gewerbe (MK&G) in Hamburg weltweit das erste Haus, das ihm eine Ausstellung widmet. Der Schwerpunkt liegt auf Glitzer als Symbol für Zugehörigkeit, Empowerment und Selbstbestimmung, rund 40 internationale Kreative thematisieren den Einsatz in politischen Kontexten und kollektiven Bewegungen. Glitzer als Ausdruck der Freude an gesellschaftlicher Vielfalt und kollektiver Ausgelassenheit sowie als Mittel des Protests.
|
|
|
|
|
Schlangestehen auf Japanisch. Diszipliniert und auf höchst entspannte Weise effizient. Zudem spart man sich auch noch das Ziehen von Wartenummern, was ohnehin gelegentlich zu Verwirrung führt, wenn der Automat plötzlich keine Nummern mehr ausspucken möchte und niemand mehr weiß, wann er eigentlich an der Reihe ist.
|
|
|
Seit der 8daw-Ausgabe BETA #13 vom 24. Juli 2020 haben wir für auf uns auf Empfehlung eines Lesers entschieden: »Der Mittelpunkt (MacOS: Shift+Alt+9; Windows: Alt+0183) wird eingesetzt wie der Asterisk *, stört jedoch deutlich weniger den Lesefluss der Leser·innen, weil er nicht nach Fußnoten ruft und auch keine Textlücken reißt wie der Gender_Gap.« Wir stellen unseren Autor·innen jedoch frei, ob sie den Mediopunkt oder eine andere Form benutzen. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind jedenfalls geschlechtsneutral zu verstehen.
|
|
|
|
Herausgeber und Chefredakteur von 8daw sowie verantwortlich im Sinne des Presserechts ist Boris Kochan [bk], Steinerstraße 15c, 81369 München, boriskochan.com,
zu erreichen unter boris.kochan@eightdaw.com oder +49 89 178 60-900
in Verbindung mit
Kochan & Partner GmbH, Steinerstraße 15c, 81369 München, news@kochan.de
Redaktion: Ulrich Müller [um] und Gabriele Werner [gw]; Chefin vom Dienst/Lektorat: Sigrun Borstelmann [sib]; Kalender: Antje Dohmann [ad]; Regelmäßige Autoren: Markus Greve [mg], Sandra Hachmann [sh], Herbert Lechner [hel], Martin Summ [mas]; Illustrationen: Martina Wember [mwe]; Bildredaktion, Photo-Editing: Pavlo Kochan [pk]; Homepage und Newsletter-Technik: Pavlo Kochan [pk]; Basisgestaltung: Michael Bundscherer [mib]; Schriften: Tablet Gothic von Veronika Burian und José Scaglione sowie Coranto 2 von Gerard Unger, beide zu beziehen über TypeTogether; Versand über Mailjet.
Bildnachweis:
© Elisaveta Porodina
|
|
|
|
Ausgabe: #145
Erschienen am: 17. Februar 2025 [KW8]
Thema: Präzision und Abweichung
Datenschutz | Kontakt | Impressum
© 2025 Boris Kochan
|
|
|
|
|
|
|
|